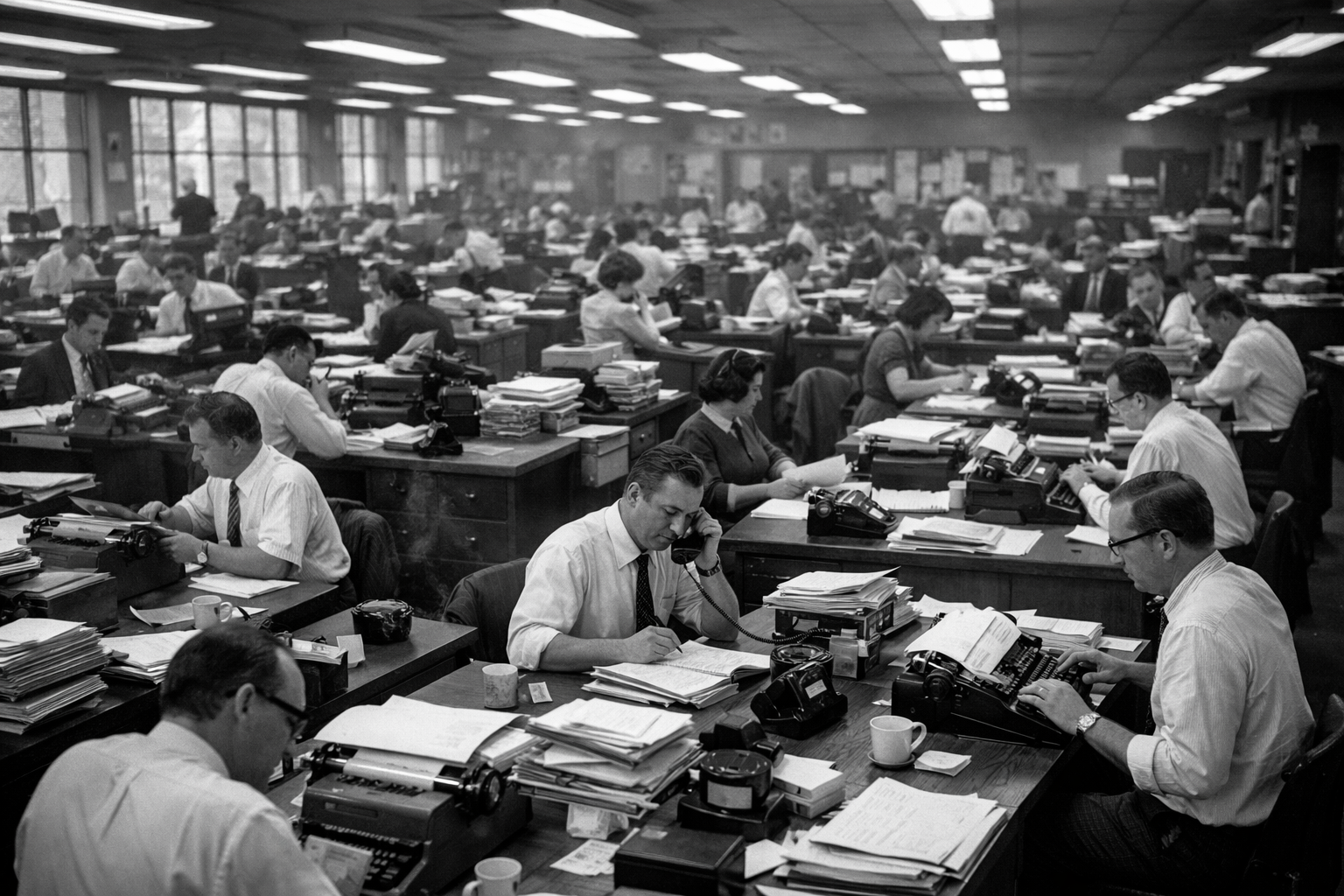Politisch frei, wirtschaftlich gefesselt: Warum der Westen an Strahlkraft verliert
Alle fühlen sich frei. Deutsche, Franzosen, Amerikaner – und ja, auch Neuseeländer oder Dänen. Doch Freiheit ist kein eindimensionales Gefühl. Politische Rechte, bürgerliche Freiheiten, Eigentumsschutz, Wettbewerbsfähigkeit, Genehmigungsgeschwindigkeiten, Steuer- und Regulatorik-Pfade – die Summe daraus ist das tatsächliche Freiheitsprofil eines Landes. Eigentlich für jeden von uns, aber sicher für Unternehmer und Investoren ist genau dieses Profil entscheidend: Es bestimmt, wie Kapital arbeiten kann, wie kalkulierbar Risiken sind – und ob Wachstum gesellschaftlich Rückenwind bekommt oder Gegenwind.
Ich möchte eine Standortbestimmung wagen. Wir im Westen beanspruchen Freiheit als unseren Kernwert, aber wo genau steht der Westen heute im weltweiten Freiheitswettbewerb – politisch, wirtschaftlich und auch kulturell? Was bedeutet das für persönliche Entfaltungsmöglichkeiten, die Kapitalallokation und die operative Skalierung von Unternehmen? Und was lernen wir aus einem vermeintlichen Paradox: Gesellschaften können politisch enger sein, aber ökonomisch und kulturell „kapitalismusfreundlicher“ als viele westliche Demokratien.
Politische Freiheit: stabil – und doch unter Erosionsdruck
Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Politische Rechte und bürgerliche Freiheiten sind in den klassischen westlichen Demokratien hoch. Das dokumentiert Freedom House seit Jahrzehnten. Deutschland, Frankreich, die USA und die Schweiz gelten in der aktuellen Ausgabe als „Free“ mit hohen Scores. Gleichzeitig beschreibt Freedom House die inzwischen 19. Folge eines globalen Rückgangs politischer Freiheit; im Jahr 2024 verschlechterten sich mehr Länder als sich verbesserten. Für Investoren ist das nicht akademisch: Politische Erosion erhöht die Varianz künftiger Policy-Wechsel – und damit Diskontfaktoren, insbesondere in regulierungsintensiven Sektoren. (Quelle)
Ja, der Westen bleibt politisch frei. Aber politische Freiheit ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr – und die Richtung ist nicht automatisch positiv. Wer operativ skaliert, muss deshalb politisches Risiko wieder so behandeln wie Zins-, Energie- oder Lieferkettenrisiko: aktiv managen statt passiv hoffen.
Wirtschaftliche Freiheit: der unterschätzte Hebel für Execution
Für die tägliche Arbeit von Unternehmern und Investoren zählt häufig noch mehr als die politische Überschrift: ökonomische Freiheit. Sie entscheidet, wie schnell man gründen, Genehmigungen erhalten, Talente einstellen, Kapital repatriieren oder Assets absichern kann. Hier liefert der Index of Economic Freedom (Heritage Foundation) ein belastbares Raster: 12 Indikatoren in vier Säulen – Rule of Law, Government Size, Regulatory Efficiency und Open Markets. Das macht den Index für die Praxis nützlich, weil er dort misst, wo Execution-Reibungen entstehen. (Quelle)
Die Standortprofile unterscheiden sich deutlicher, als viele annehmen. Deutschland wird 2025 mit 71,6 Punkten als „mostly free“ eingestuft und liegt global auf Rang 22 (Europa: Rang 14) – 0,5 Punkte schwächer als im Vorjahr. Frankreich rangiert deutlich darunter, die USA verzeichnen seit Jahren einen leichten Abwärtstrend, während kleinere, reformfreudige Volkswirtschaften (Irland, Estland u. a.) überproportional gut abschneiden. Für die Praxis heißt das: In einem Land mit gleicher politischer Freiheit kann der ökonomische „Durchsatz“ an Bürokratie, Steuer- und Arbeitsmarktregeln sehr verschieden sein. (Quelle)
Ebenfalls relevant: der Human Freedom Index (Fraser Institute/Cato). Er kombiniert persönliche und wirtschaftliche Freiheit zu einer 0–10-Skala und illustriert die „Mischung“ eines Landes. In der 2024er Ausgabe liegt die Schweiz auf Platz 1, Deutschland auf 14, USA und UK teilen Rang 17, Frankreich rangiert auf 34. Diese Mischzahl ist nützlich, um die politische Erzählung mit der wirtschaftlichen Realität zusammenzubringen – und erklärt, warum zwei „freie“ Länder unternehmerisch sehr unterschiedliche Friktionen erzeugen können. (Quelle)
Die kulturelle Dimension: Kapitalismus-Freundlichkeit vs. Neidgesellschaft
Worüber Unternehmer wenig reden, was aber Gesellschaften deutlich beeinflusst: Wie blickt eine Gesellschaft auf Reichtum, Unternehmertum, Leistung? Genau hier setzt die Arbeit von Rainer Zitelmann an. Er hat mit dem Social Envy Coefficient (Verhältnis „Neider“ zu „Nicht-Neidern“), dem Personality Trait Coefficient (positive vs. negative Zuschreibungen an Reiche) und dem daraus abgeleiteten Rich Sentiment Index vergleichbare Messpunkte geliefert. Die Kernergebnisse sind unangenehm klar: Frankreich und Deutschland zeigen in den Studien eher hohe Neidwerte und negativere Zuschreibungen; USA und UK deutlich geringere Neidniveaus; Länder in Ostasien – Japan, Südkorea, Vietnam – sind überraschend kapitalismusfreundlich in der Einstellung zum Wohlstand. (Quelle)
Warum ist das für die Praxis relevant? Weil gesellschaftliche Akzeptanz von Vermögensbildung in der Regel mit geringerer politischen Nachfrage nach „Straf“-Regulatorik einhergeht. Hoher Sozialneid korreliert empirisch mit höherer Zustimmung zu vermögensorientierter Besteuerung und zu breiter Regulierung – und damit zu höheren Transaktionskosten für Wachstum. Umgekehrt schaffen positive Aufstiegsnarrative einen Rückenwind für Wagnis: Gründer und Kapitalgeber werden nicht als Problem gesehen, sondern als Lösung. Für Standorte ist das ein immaterieller, aber robuster Wettbewerbsvorteil.
Der spannende Ausreißer ist Vietnam: politisch nicht frei im westlichen Sinne, aber mit einer überdurchschnittlich positiven Einstellung zu Reichtum und Unternehmertum. In Umfragen wird „Kapitalismus“ dort nicht negativ konnotiert; junge Vietnamesen nennen Japan, Südkorea – und zunehmend die USA – als Vorbilder. Das Paradox ist real: kulturelle Kapitalismus-Freundlichkeit entsteht nicht exklusiv in liberalen Demokratien. Für Investoren ist das Signal eindeutig: Attitude-Alpha existiert – wer frühe kulturelle Momentumwellen erkennt, antizipiert Regulierungspfade und Marktdurchdringung besser. (Quelle)
Der Westen: noch Benchmark – aber nicht mehr Monopol
Setzen wir die Puzzleteile zusammen. Politisch bleibt der Westen Vorbild – mit deutlichen Erosionsanzeichen. Ökonomisch ist das Bild gespalten: Während Teile Europas regulierungsstark sind und die USA in Einzelindikatoren zurückfallen, behaupten kleinere, reformdynamische Volkswirtschaften die Spitze. Kulturell zeigen Teile Asiens eine hohe Aufstiegsorientierung, die – verbunden mit industrieller Politik – in den nächsten zehn Jahren zu Investitionsmagneten werden kann. Der Human Freedom Index unterstreicht die Heterogenität: Top-Plätze bleiben westlich geprägt, aber der Vorsprung ist kein Naturgesetz.
Für die Kapitalallokation heißt das: Die alte Heuristik „Westeuropa/USA = beste Freiheitsrendite“ funktioniert nicht mehr blind. Sie muss ersetzt werden durch ein Dreifach-Screening: politische Stabilität (Freedom House), ökonomische Freiheit (Heritage) und kulturelle Kapitalismus-Freundlichkeit (Zitelmann-Metriken als Proxy). Wer dieses Triptychon konsequent anlegt, verteilt nicht nur Ländergewichte anders – er verändert die Reihenfolge der Schritte: Häufig wird man heute in regulierungsärmeren, kapitalfreundlicheren Jurisdiktionen starten, Produkt-Markt-Fit und regulatorisches „Pattern“ dort absichern und erst dann in größere, schwerere Märkte expandieren.
Technologie-Souveränität als Prüfstein: die Karp-These
Ein zentraler Aspekt, der in Freiheitsdebatten häufig fehlt, ist die technologische Basis. Alexander C. Karp macht in seinem Buch The Technological Republic klar: Politische Freiheit bleibt eine leere Formel, wenn der Westen die technologische Kontrolle über Schlüsselbereiche verliert. Es geht nicht nur um KI und Daten, sondern um das gesamte industrielle Fundament – von Software über Infrastruktur bis hin zu Verteidigungssystemen.
Karp kritisiert, dass das Silicon Valley sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu stark auf Konsum, neue Märkte und die Optimierung von Werbung und Plattformökonomien konzentriert hat. Damit sei ein Großteil der Innovationskraft fehlgeleitet worden – weg von der Sicherung westlicher Werte, hin zu kurzfristigen Geschäftsmodellen. Seine Diagnose: Wenn der Westen wieder ernsthaft freiheitliche Führungsrolle beanspruchen will, dann muss er in die großen, harten Technologien investieren, die Souveränität und Selbstverteidigung garantieren.
Für Investoren ist das doppelt relevant: Erstens rücken staatlich-technologische Partnerschaften wieder ins Zentrum – von Energie- und Rechenzentren über Verteidigungsindustrie bis hin zu kritischer Infrastruktur. Zweitens steigt der Wert von Standorten, die schnell und pragmatisch regulieren können, ohne Innovation zu erdrosseln. Genau an diesem Punkt treffen sich ökonomische Freiheit und technologische Ambition – wer hier Tempo und Tiefe erreicht, bestimmt die nächste Epoche westlicher Wettbewerbsfähigkeit. (Quelle)
Was bedeutet das ganz konkret – für Unternehmer und Investoren?
1. Portfolio- und Pipeline-Design nach Freiheitsprofil
Nutzen Sie den Heritage-Index als Frühindikator für Execution-Friction. Prüfen Sie in Zielmärkten die Säulen „Regulatory Efficiency“ und „Open Markets“ – dort sitzen die Engpässe, die Projekte bremsen: Arbeitsrecht, Genehmigungen, Devisen- und Investitionsfreiheit. Ergänzen Sie das mit Freedom-House-Scores, um politische Volatilität besser zu gewichten – insbesondere in Wahljahren oder bei schwacher Gewaltenteilung. Und legen Sie eine kulturelle Linse drüber: In Märkten mit niedrigem Sozialneid und positiver Reichtums-Wahrnehmung skaliert Vertrieb oft schneller, weil Erfolg kein Rechtfertigungsakt ist
2. Sequenz statt Dogma
„Start in den größten Markt“ war früher plausibel. Heute ist „Start dort, wo wirtschaftliche Freiheit + Kapitalismus-Freundlichkeit hoch sind“ oft überlegen: schnelleres Lernen, geringeres regulatorisches Klumpenrisiko, bessere Kapital-Effizienz. Skalierung in anspruchsvollere Märkte folgt, wenn Produkt, Prozesse und Compliance „härten“. Der HFI hilft hier als Kompass, weil er politische und ökonomische Dimension integriert.
3. Standort für Teams, IP und Liquidität
Steuer- und Vermögensfragen sind wichtig – aber nicht hinreichend. Entscheidend sind Genehmigungs- und Justizgeschwindigkeiten, Eigentumsschutz und Planbarkeit von Regulatorik. Heritage misst das in „Rule of Law“ und „Open Markets“. Wer IP-intensiv baut, sollte dort sein Rückgrat platzieren, wo Recht und Kapitalflüsse robust sind – und wo Gesellschaften Unternehmer nicht als moralisches Problem framen. Das reduziert „Non-Business-Risks“ im Alltag.
4. Tech-Souveränität als Alpha-Quelle
Karps Argument ist für Allokatoren handfest: Märkte, die Staat–Tech-Kooperationen institutionalisieren, werden in AI, Cyber, Dual-Use-Hardware überproportional Chancen bieten – allerdings mit Governance-Ansprüchen. Wer dort investiert, braucht Policy-Literalität: die Fähigkeit, demokratische Legitimation und sicherheitspolitische Notwendigkeiten zugleich zu lesen.
5. Kommunikation ins Ökosystem
Kapitalismus-Freundlichkeit ist gestaltbar. Branchen, die systematisch Nutzwert und Aufstiegsmöglichkeiten zeigen, verringern den politischen Druck auf neue Abgaben/Verbote. Das ist kein PR-Gag, sondern Risikomanagement. Zitelmanns Befunde legen nahe: Je nachvollziehbarer Leistung und Nutzen von Vermögensbildung sind, desto geringer die Neigung zu „Straf-Politik“.
Fazit: Freiheit neu denken – als Portfolio aus Politik, Markt und Kultur
Der Westen ist nicht abgeschrieben. Aber er hat keinen alleinigen und ideologischen Anspruch auf das Thema Freiheit. Der Westen ist nicht „abgeschrieben“. Aber er ist nicht mehr allein der Maßstab. Politisch bleibt er stark; ökonomisch ist er uneinheitlich; kulturell ringt er mit sich selbst. Wer heute Standortentscheidungen trifft, sollte Freiheitsprofile dreidimensional lesen:
1. Politische Freiheit als Absicherung gegen Willkür.
2. Wirtschaftliche Freiheit als Hebel für Geschwindigkeit und Kapital-Effizienz.
3. Kapitalismus-Freundlichkeit als soziales „Schmiermittel“, das Wachstum legitimiert und Regulierungsdruck dämpft.
Daraus folgt kein einfacher neuer Trend in Richtung Asien – sondern ein präziseres Welt-Portfolio. Es gibt weiterhin westliche Top-Standorte. Es gibt zugleich nicht-westliche Märkte mit erstaunlich hoher Aufstiegsenergie. Und es gibt Länder, in denen die politische Rhetorik von Freiheit zwar laut ist, die ökonomische Realität aber langsam schwerer wird. Wer Investitionen, Gründungen und Skalierung so strukturiert, wird in einer multipolaren Freiheit neue Chancen finden: Freiheit als Strategie – nicht als Ideologie.
Ein Wort zur Methode – was die Indizes tatsächlich messen
Freedom in the World (Freedom House) bewertet jährlich politische Rechte und bürgerliche Freiheiten (0–100, basierend auf 25 Indikatoren). Das liefert eine robuste Messung der politischen Dimension von Freiheit und ist über Dekaden vergleichbar; die Methodenseite und das Jahres-PDF sind öffentlich dokumentiert. Für Investoren zeigt der Report, wie verlässlich Gewaltenteilung, Medienfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenschutz sind – also die Basis „harte“ Eingriffe ex ante zu erkennen.
Index of Economic Freedom (Heritage) misst 12 Indikatoren in vier Säulen: Rule of Law (Eigentumsrechte, Justizeffektivität, Integrität), Government Size (Steuerlast, Staatsausgaben, fiskale Gesundheit), Regulatory Efficiency(Unternehmens-, Arbeits-, Geldpolitik) und Open Markets (Handel, Investitionen, Finanz). Für Unternehmer ist das der beste Proxy für Execution-Friction: Je höher der Score, desto geringer tendenziell die Reibung in Gründung, Betrieb, Scaling, Kapitalbewegungen. Länderprofile (z. B. Deutschland 2025: 71,6 Punkte, Rang 22) erlauben „Drill-downs“ auf Schwachstellen
Human Freedom Index (Fraser/Cato) kombiniert persönliche und ökonomische Freiheit zu einer 0–10-Skala und bildet damit die Mischung ab. Die Top-10 (u. a. Schweiz, Neuseeland, Dänemark, Luxemburg, Irland, Finnland, Australien, Island/Schweden, Estland) liefern ein konsistentes Signal: In dieser Gruppe korrelieren Freiheit und Wohlstandsindikatoren hoch – Median-Einkommen der freiesten Quartile liegen deutlich über denen der unfreiesten. Für Investoren ist der HFI die Makro-Landkarte: Wo lohnt sich ein tieferer Blick auf Sektoren und Standortmodule? (Quelle)
Zitelmann-Indizes sind keine „Freiheitsindizes“, sondern kulturelle Messgrößen: Social Envy Coefficient, Personality Trait Coefficient und Rich Sentiment Index erfassen Einstellungen gegenüber Reichtum und Unternehmertum. Für die Praxis sind sie wertvoll, weil sie politische Nachfrage nach Eingriffen antizipieren helfen: Hoher Neid → höhere Wahrscheinlichkeit für belastende Maßnahmen; niedriger Neid → höhere gesellschaftliche Toleranz für Wachstum und Vermögensbildung. Datengrundlagen und Peer-Review-Publikationen liegen offen. (Quelle)