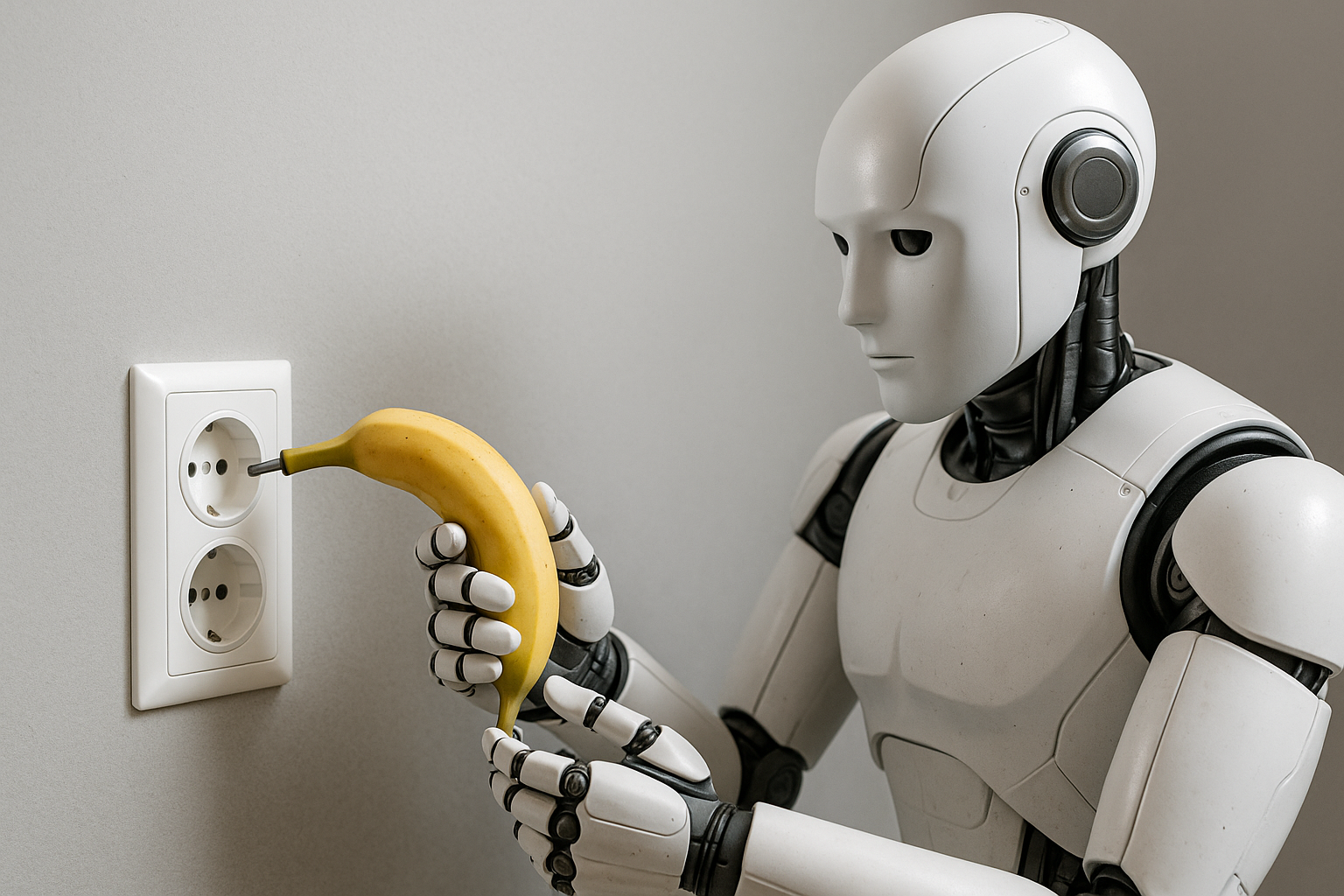Souveränität heißt Wahlfreiheit – und die entsteht nur durch starke, wettbewerbsfähige Player
Digitale Souveränität ist zum Standardschlagwort der IT-Branche geworden. Wer glaubt, sie durch die Bevorzugung schwacher europäischer Anbieter zu erreichen, verkennt den Kern. Souveränität bedeutet Wahlfreiheit – und Wahlfreiheit gibt es nur, wenn europäische Lösungen mit amerikanischen und asiatischen Alternativen mithalten können. Alles andere ist Selbstbetrug. Protektionismus schafft keine Stärke, er zementiert Abhängigkeit.
Souveränität heißt Wahlfreiheit
Souveränität ist die Fähigkeit, zwischen gleichwertigen Lösungen frei zu wählen. Ein Staat bleibt nur souverän, wenn er außenpolitisch handlungsfähig ist; ein Unternehmen nur, wenn es bei Rohstoffen, Maschinen, Software oder Cloud ernsthafte Alternativen hat. Im Digitalen heißt das: Ohne konkurrenzfähige europäische Player ist „digitale Souveränität“ ein Etikett – ohne Inhalt.
Beispiel Cloud: In Europa halten AWS, Microsoft und Google zusammen rund 70 % Marktanteil; europäische Anbieter verharren seit Jahren bei ~15 %. Das ist keine tragfähige Alternative, sondern ein Stabilisieren der Abhängigkeit auf niedrigerem Niveau. GAIA-X wurde als Hebel für Souveränität präsentiert – ist aber in der Sache Governance/Standards für föderierte Datenräume, kein Hyperscaler-Produkt. Wer dort eine „europäische Cloud“ suchte, suchte am falschen Ort. (Quelle)
Warum Souveränität nicht angeordnet werden kann
Souveränität lässt sich nicht beschließen: Sie entsteht aus Wettbewerb und Attraktivität – oder gar nicht. Regulierung (Datenschutz, ESG, Lieferketten) hat legitime Ziele, schafft aber keine Nachfrage nach schlechteren Produkten. Sie verteuert, verlangsamt, verhindert Skalierung – und treibt Nutzer am Ende zu stärkeren Alternativen.
Fallbeispiel Northvolt: Der europäische Batteriepionier stand für Unabhängigkeit von Asien – und landete nach massiven Verzögerungen, Kostenanstiegen und Qualitätsproblemen in der Insolvenz. In Schweden wurde die Produktion eingestellt; in Deutschland hält die Politik am Standort Heide fest, doch die Struktur bleibt fragil. Parallel wurde bekannt, dass der Bund bzw. die KfW mit ~600 Mio. € in der Pflicht stehen – ein Preiszettel, der die Grenzen politischer Industriepolitik offenlegt. Botschaft: Geld ersetzt keine Skalierungsfähigkeit. (Quelle)
Der deutsche Irrweg: Bevorzugung statt Wettbewerb
„Kauft europäisch!“ klingt nach Souveränität, ist aber im Kern ein Bevorzugungsprogramm. Wer schlechtere europäische Produkte vorschreibt, zerstört Wahlfreiheit – und damit Souveränität. Statt Alternativen zu bauen, zementieren wir Abhängigkeit von schwachen Anbietern und bestrafen jene, die global konkurrenzfähige Lösungen liefern. So entsteht kein Ökosystem, das Talente, Kapital und Kunden anzieht, sondern eine Scheinwelt, in der politische Gütesiegel technische Defizite überdecken sollen.
Was echte Souveränität braucht
Starke Player statt Kleinanbieter: Souveränität entsteht aus Skalierung, nicht aus handgestrickten Sonderlösungen. Wer in globalen Infrastrukturen – Cloud, Chips, KI, Security – mitreden will, braucht europäische Unternehmen, die in der ersten Liga spielen.
Marktdynamik statt Subventionen. Wettbewerb baut Champions – Kommissionen bauen Papiere. Förderung kann Anreize setzen, ersetzt aber nicht Produkt/Kundenvorteile. Ohne klaren Produkt-Markt-Fit bleibt jeder Zuschuss ein Strohfeuer.
Unternehmerische Radikalität: Europa feiert punktuell Unicorns – was fehlt, sind Innovationsmaschinen, die jährlich hunderte Startups akquirieren, integrieren und skaliert weiterentwickeln. Disruption entsteht nicht im Beirat, sondern in der Fabrikhalle, im Rechenzentrum – und im Verkaufsprozess.
Kapital und Exits: Souveränität braucht europäisches Langfristkapital und funktionierende Exit-Märkte. Solange Pensionskassen/Versicherer überwiegend US-Tech finanzieren, bleibt Europa der Zulieferer – nicht der Taktgeber.
Fallbeispiel Halbleiter: Europa hat mit ASML ein Kronjuwel, ohne dessen EUV-Lithografie es keine modernen 7/5/3nm-Chips gäbe. Statt diese Stärke zum Nukleus einer fokussierten Industriepolitik zu machen, zerfasert Europa Förderprogramme. Taiwan zeigt mit TSMC, wie Fokussierung und Cluster-Logik zu Weltmarktführerschaft führen. (Quelle)
Der falsche Weg: regulatorisch gezähmte Kleinanbieter
Handarbeit ist keine Souveränität: Wer lokale „DSGVO-konforme“ Cyber-Kleinlösungen gegen skalierende Sicherheitsplattformen stellt, kauft Schein-Souveränität – zu Lasten der Sicherheit und der Kostenkurve.
In der Breite dominieren globale Plattformen, die kontinuierlich neue Bedrohungen abbilden, Updates weltweit ausrollen und Netzwerkeffekte realisieren. Nationale Sonderwege geben ein gutes Gefühl – aber selten bessere Sicherheit, Geschwindigkeit oder TCO.
Der richtige Weg: Weniger Regulierung, mehr Markt
Wettbewerb vor Bevorzugung: Datenschutz und ESG brauchen Balance, sonst verhindern sie Skalierung. Regeln setzen Leitplanken – nicht Produktstrategien.
Preiswerte Energie – jetzt: Für Industrie/Cloud zählt die kWh-Realität: In den USA liegt der industrielle Strompreis um ~8–9 ¢/kWh (Juni 2025), in Deutschland für kleine/mittlere Industriebetriebe ~18 ct/kWh (2025). Mit dieser Lücke baust du keine Rechenzentren, keine Chipfabriken – und keine Souveränität. (Quelle)
Ein klarer westlicher Standpunkt: Souveränität ist auch Werte-Souveränität: Demokratie, Rechtsstaat, Leistung. Das gilt für alle, die hier leben – und arbeiten – wollen.
Leistungsprinzip statt Protektionismus: Marktanteile werden verdient, nicht zugeteilt. Wer Kunden echte Vorteile liefert, gewinnt – egal ob US, europäisch oder asiatisch. Nur so entstehen echte Alternativen – und damit Wahlfreiheit.
Praxisnah gedacht: Wie wir mit Kunden souverän entscheiden
Transparenz statt Dogma: Wir legen Kunden alle tragfähigen Optionen auf den Tisch – US-Lösungen, europäische, asiatische. Entscheidungskriterien sind Funktion, Sicherheit, TCO, Migrationsrisiken, Exit-Klauseln. Wer hier europäische Anbieter künstlich bevorzugt, schadet ihren Chancen langfristig: Sie lernen nicht am härtesten Maßstab, dem globalen Wettbewerb.
Vendor-Lockin aktiv reduzieren: Multi-Cloud-Designs, offene Schnittstellen, reversible Datenarchitekturen und saubere Vertrags-Exit-Regeln sind die Realpolitik der Souveränität. Selbst US-Hyperscaler bewegen sich unter regulatorischem Druck: In Europa hat Google etwa Datentransfer-Gebühren für Multi-Cloud-Kunden gestrichen – ein Zeichen, dass Wettbewerb wirkt. Souveränität wächst dort, wo Wechselfähigkeit real ist. (Quelle)
Datenräume und Interoperabilität: GAIAX bleibt sinnvoll als Regelwerk für föderierte Datenräume, Identitäten, Kataloge, Compliance. Wer es als „Cloud-Ersatz“ missversteht, verpasst den Nutzen – und produziert Enttäuschung. Standards sind Mittel, keine Produkte. (Quelle)
Fazit – Souveränität entsteht durch Stärke, nicht durch Schutz
Digitale Souveränität ist keine Verordnung und kein Protektionismus-Projekt. Sie ist die Fähigkeit, zwischen starken, gleichwertigen Lösungen zu wählen. Der Hype um „digitale Souveränität“ ist deshalb kein neues Marktsignal für deutsche und europäische IT-Dienstleister.
Souverän werden wir nur, wenn wir unseren Kunden alle Optionen offenlegen – US-Lösungen, asiatische, europäische – und den Wettbewerb entscheiden lassen. Wer stattdessen schwache europäische Anbieter künstlich bevorzugt, verzerrt den Markt und beschleunigt unseren Niedergang.
Nicht Schutz, sondern Stärke.
Nicht Bevorzugung, sondern Wettbewerb.
Nicht Symbolpolitik, sondern Skalierung.
Wenn Europa in den nächsten fünf Jahren keine digitalen Champions skaliert, bleibt „digitale Souveränität“ ein politisches Schlagwort – während andere längst Fakten schaffen.