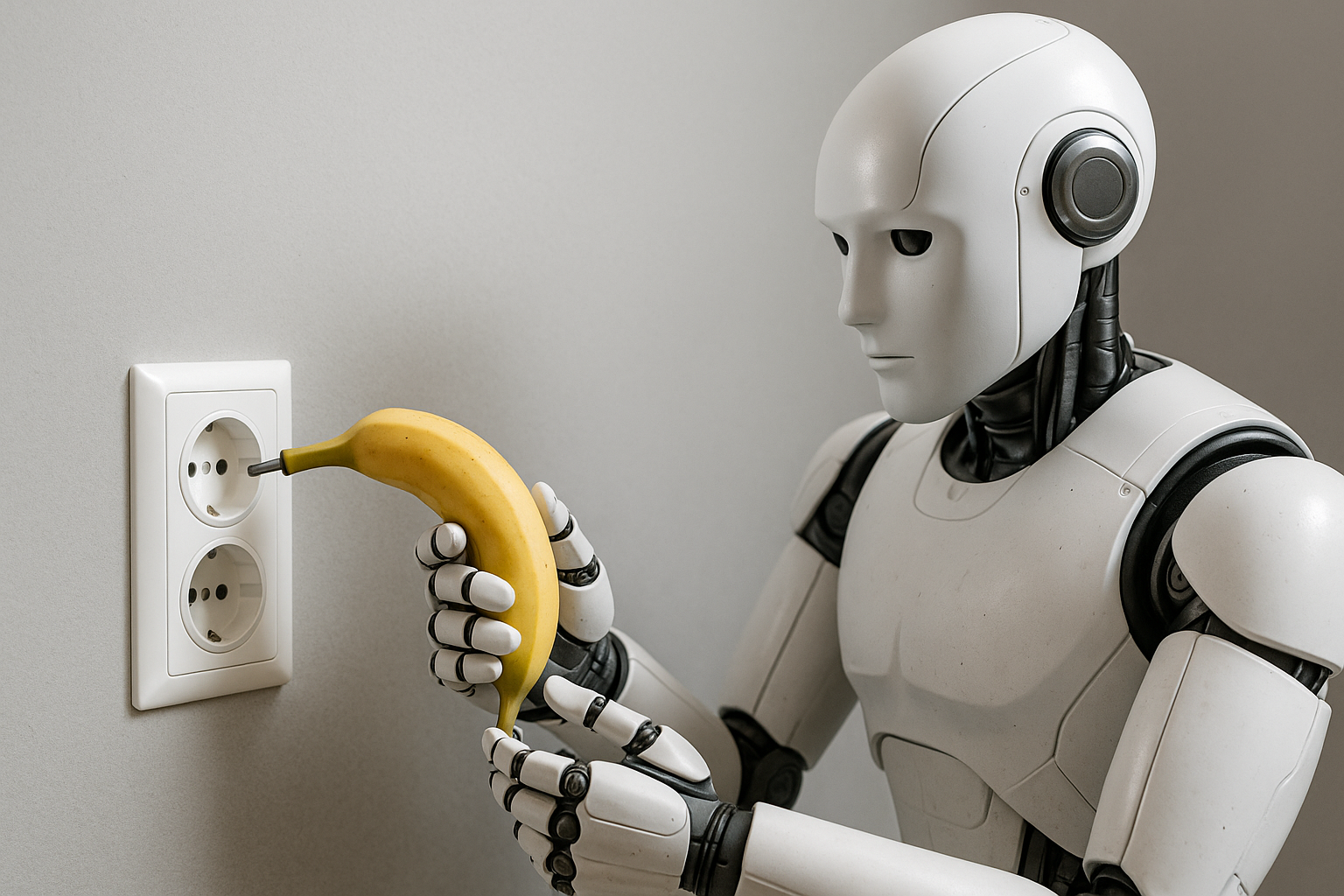Vom Glanz vergangener Imperien
Zuerst waren es die Niederländer, die mit ihren Schiffen die Welt besegelten und den Welthandel kontrollierten. Dann folgten Franzosen und Engländer, die Kolonialreiche errichteten und Handelswege militärisch absicherten. Europa war über Jahrhunderte das Zentrum ökonomischer und politischer Macht, weil es den Handel dominierte – und damit die Ströme von Kapital und Ressourcen.
Doch dieser Glanz ist lange vorbei. Nach zwei Weltkriegen übernahmen die USA die Rolle des Garanten des globalen Handels. Sie hielten Seewege offen, sicherten den Dollar als Weltwährung und schufen mit Bretton Woods, IWF und WTO die Infrastruktur, die globalen Handel möglich machte. Doch anders als die Europäer zuvor partizipierten die Amerikaner nicht mehr direkt an jedem Geschäft. Sie bauten kein Imperium von Häfen und Handelsstützpunkten, sondern kontrollierten den Handel indirekt – als Systemarchitekt und Schiedsrichter.
Heute verschiebt sich die Logik erneut. Im 21. Jahrhundert entscheidet nicht mehr die Beherrschung der Handelswege über globale Macht, sondern die Fähigkeit zur Skalierung. Wer industrielle Produktion und künstliche Intelligenz in großem Maßstab beherrscht, der kontrolliert Kapitalströme, Innovation und letztlich geopolitischen Einfluss. Willkommen im Jahrhundert der Skalierung.
Skalierung als neues Machtprinzip
Was bedeutet Skalierung? Im Kern geht es darum, durch Masse und Technologie exponentielle Lernkurven zu realisieren. Das ökonomische Gesetz dahinter ist Wright’s Law: Mit jeder Verdopplung der kumulierten Produktion sinken die Kosten um einen vorhersehbaren Prozentsatz. Wer skaliert, lernt schneller, produziert günstiger, wird effizienter – und zieht immer mehr Kapital an.
China hat dieses Prinzip perfektioniert. Nicolas Colin (Quelle) hat es in seiner jüngsten Analyse auf den Punkt gebracht: Chinas industrielle Dominanz beruht nicht mehr auf Billiglöhnen, sondern auf der Marshallian Trinity – einer dichten Masse an Ingenieuren, schnellem Zugang zu Kapital und moderner Infrastruktur, getragen von staatlich orchestrierten Institutionen. Daraus ist ein industrielles Ökosystem entstanden, das sich selbst verstärkt.
Die Zahlen sind eindeutig: China kontrolliert 32 Prozent der weltweiten Industrieproduktion, die USA nur 15 Prozent. Bis 2030 wird die Schere auf 40 zu 11 Prozent auseinandergehen. China produziert dreizehnmal so viel Stahl wie die USA, baut 232-mal mehr Schiffe nach Tonnage und liefert 60 Prozent aller globalen Elektroautos. Es verbraucht 30 Prozent der weltweiten Elektrizität und fügt jährlich mehr Solarkapazität hinzu, als die USA in ihrer Geschichte installiert haben. Jedes Jahr strömen 1,6 Millionen Ingenieure in die chinesische Wirtschaft, während Amerika mehr Juristen als Ingenieure hervorbringt.
Diese Skalierung ist nicht nur ein industrielles Phänomen. Sie ist geopolitische Währung. Wer ganze Industrien im Maßstab baut, kann Weltmarktpreise diktieren, Standards setzen und Kapitalströme lenken.
Europa im industriellen Dilemma
Und Europa? Auf den ersten Blick ist die Industrie noch stark. Deutschland exportierte 2023 Maschinen im Wert von 66,8 Milliarden Euro, Norditalien glänzt mit Luxusgütern und Spezialmaschinen, Skandinavien mit Cleantech, Frankreich hält eine nukleare Industriekompetenz. 24 Prozent der europäischen Wirtschaft basieren auf Industrie – im Vergleich zu 11 Prozent in den USA.
Doch die Realität ist trügerisch. Europas Anteil an der weltweiten industriellen Wertschöpfung fiel von 27 Prozent im Jahr 2000 auf 16 Prozent 2014 – und sinkt weiter. Chinas Stahlproduktion übertrifft die europäische inzwischen um das Sechsfache.
Europa ist stark dort, wo Skalierung am wenigsten zählt: bei maßgeschneiderten Maschinen, im Luxussegment, bei spezialisierter Ingenieurskunst. Ein deutscher Werkzeugmaschinenbauer verkauft nicht nur ein Gerät, sondern jahrelange Beratung und Service. Das ist wertvoll – aber es skaliert nicht. Fragmentierung verschärft das Problem: Unterschiedliche Sprachen, Regulierungen und Märkte zwingen zu maßgeschneiderten Lösungen.
Frankreichs Nuklearprogramm zeigt die Falle: Im Inland konnte man durch Standardisierung 58 Reaktoren effizient bauen. Doch im Export brach dieses Modell zusammen, weil jeder Markt eigene Spezifikationen verlangte. Skaleneffekte verpufften, Kosten explodierten.
Hinzu kommt die strukturelle Schieflage der Eurozone. Im Süden blockiert hohe Arbeitslosigkeit industrielle Kapazität, im Norden hält Lohndruck trotz Exportstärke die Nachfrage niedrig. Ein gemeinsamer Währungsraum, der niemandem wirklich passt. Europa ist stark in Nischen – aber schwach in der Logik der Skalierung.
KI als neue Skalierungsarena
Während China durch industrielle Masse dominiert, haben die USA ein neues Schlachtfeld eröffnet: Künstliche Intelligenz.
Die Amerikaner kontrollieren die gesamte Wertschöpfungskette: Chips von NVIDIA, Foundation Models von OpenAI, Anthropic, Google und Meta, Datenplattformen wie Snowflake oder Databricks und Enterprise-Operatoren wie ServiceNow und Figma. Dazu ein Finanzsystem, das Milliarden in wenigen Monaten in neue KI-Player pumpt. KI ist keine Randtechnologie – sie ist der neue Betriebscode der Wirtschaft.
China verfolgt einen anderen Weg. Trotz US-Sanktionen bei High-End-Chips integriert es KI massiv in Produktion, Lieferketten und Massenmärkte. Es nutzt Datenfülle und Skaleneffekte, um Anwendungen voranzutreiben, selbst wenn die Basismodelle technologisch hinter US-Niveau bleiben.
Und Europa? Abgehängt. Kein global relevanter Champion bei Chips oder Foundation Models. Zersplitterte Märkte, zu wenig Kapital, überreguliert durch den AI Act. Die Gefahr: Europa wird zum Konsument amerikanischer und chinesischer Systeme – und nicht mehr zum Gestalter.
Doch KI ist nicht nur Technologie. Sie ist der neue Hebel für Skalierung. Wer KI kontrolliert, kann Lernkurven komprimieren, Produktionsprozesse beschleunigen und ganze Branchen neu ordnen. Im Jahrhundert der Skalierung ist KI die universelle Fabrikmaschine – und Europa steht nicht einmal auf dem Spielfeld.
Europas Kakophonie und Ambitionslosigkeit
Das größte Problem ist nicht die Technologie, sondern die Struktur. Europa spricht nicht mit einer Stimme. Statt eines strategischen Projekts herrschen nationale Einzelinteressen, ein regulatorischer Flickenteppich und politische Selbstblockaden.
Brüssel schafft es, Datenschutz bis ins letzte Pixel zu regulieren, aber nicht, eine Industrievision zu formulieren. Nationale Politik denkt in Wahlzyklen, nicht in Generationen. Die Euro-Kompromisse lähmen jede Anpassung. Europas Realität ist eine Kakophonie – während die USA und China mit klarer Stimme agieren.
Deutschland und Frankreich stecken fest in einem System der Umverteilung, das kurzfristig Ruhe bewahren soll, langfristig aber jede Dynamik erstickt. Politik und Verbände beschwichtigen und verschweigen den Bürgern die Dramatik der Lage – aus Angst, die Illusion könnte platzen, man könne „noch ein paar Jahre so weitermachen“.
Das müssen wir wollen – eine Allianz der Macher
Europa könnte einen dritten Weg gehen. Nicolas Colin (Quelle) beschreibt das Potenzial: die Verbindung von Startups („New Industrials“) und etablierten Industrie-Champions („Legacy Industrials“) zu einem neuen industriellen Geflecht. KI kann helfen, Lernkurven auch ohne Massenskalierung zu komprimieren. Clusterbildung, patient capital und neue Produktionsmodelle sind vorhanden – auf dem Papier.
Doch Papier reicht nicht. Das müssen wir wollen.
Mit der heutigen EU-Struktur geht es nicht. Zu viel Regulierung, zu viel Kakophonie, zu wenig Gestaltungswille. Wir dürfen nicht nach dem Staat rufen – wir haben längst zu viel Staat. Wir müssen uns von der Illusion lösen, dass Politik uns rettet oder das Denken abnimmt.
Wer Europas und Deutschlands Zukunft sichern will, muss eine Allianz der Macher schmieden: Unternehmer, Industrie, Investoren und Tech-Startups, die jenseits der Politik Strukturen bauen, die wirklich tragen.
Und wir dürfen uns nicht mit dem Traum vom „Hidden Champion“ zufriedengeben. Was wir brauchen, sind kapitalmarktfähige Strukturen: Unternehmen, die an einer starken europäischen Börse notiert sind und Strahlkraft wie Nasdaq oder Wall Street entfalten. Kein Klein-Klein, kein Mittelmaß. Wir brauchen größenwahnsinnige, visionäre Unternehmer und Macher, die die Welt erobern und verändern wollen.
Denn Mittelstand schafft in der Welt von morgen keine Resilienz mehr – er ermöglicht schlicht keine Skalierung.
Es geht nicht um nationale Industriestrategien, nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner in Brüssel. Es geht um die, die handeln und wollen – und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Eine Allianz, die KI und Industrie verschmilzt, nicht als Regulierungsvorhaben, sondern als unternehmerisches Projekt. Nur so entsteht ein dritter Weg – jenseits der US-Plattform-Logik und der chinesischen Massenskala.
Fazit: Europas Entscheidung im Jahrhundert der Skalierung
Die Geschichte lehrt: Macht folgt dem, der die Infrastruktur des Zeitalters kontrolliert. Die Niederländer kontrollierten die Schifffahrt. Die Engländer die Handelswege. Die USA die Weltfinanz und das offene Handelssystem. Heute kontrolliert China die industrielle Masse – und die USA dominieren die KI.
Und Europa? Es muss entscheiden. Entweder bleibt es Zuschauer, gefangen in nationaler Kakophonie und regulatorischem Kleinmut. Oder es schmiedet eine Allianz der Machenden, die KI in die industrielle DNA integriert – und so Skalierung ohne Masse schafft.
Das Jahrhundert der Skalierung duldet keine Zaungäste. Wer nicht handelt, wird von den Kurven der anderen überrollt. Wer aber Willens ist, kann einen dritten Weg schaffen: intelligenter, vernetzter, fokussierter. Europas Zukunft hängt nicht von Politik ab, sondern vom Mut derjenigen, die jetzt Verantwortung übernehmen – und machen.